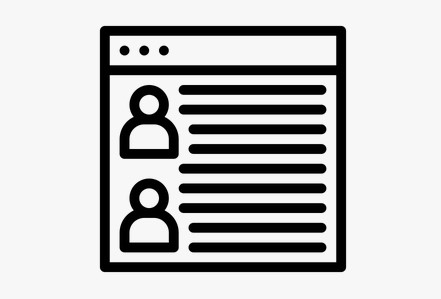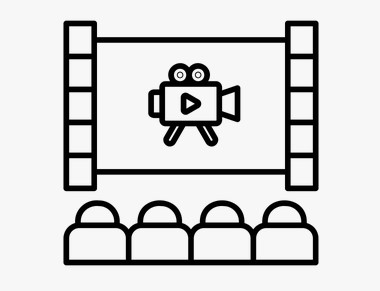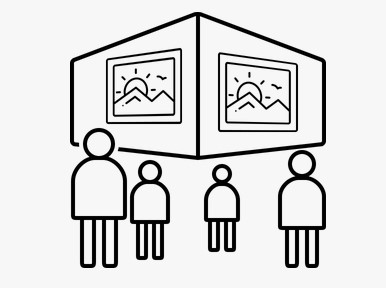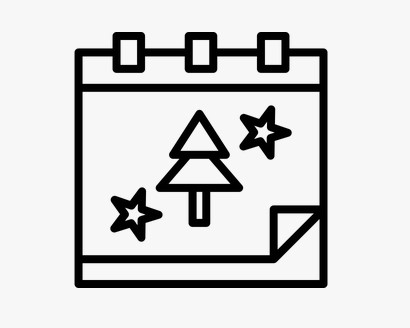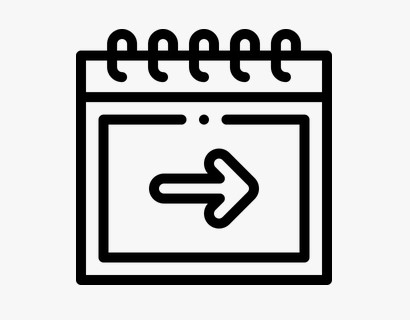Ich muss vorab zugeben: Ich bin kein großer Fan von Sargnagel. Zu görenhaft feministisch, zu grobschlächtig ist mir ihr Humor, den ich bisher v.a. aus „Falter“-Karikaturen kannte. Ihr neues Buch über einen Lehrauftrag am Grinell College, einer Privatuni im Mittleren Westen, über Kreatives Schreiben, bei dem sie von Christiane Rösinger, Liedermacherin und ehemalige Leadsängerin der Lassie Singers, begleitet wird, hat mich positiv überrascht: Die inzwischen etablierte Undergrounds-Autorin hat eine feine Beobachtungsgabe und einen Sinn für unterhaltsame Skurrilitäten aller Art. Es ist halt nur leider so, dass der Zielort in the middle of nowhere der USA nicht viel zu bieten hat. Halbwegs interessante Ausflugsziele der Sargnagel und Rösinger erfordern eine stundenlange Anreise per Auto – und selbst das ist nicht leicht zu bekommen, da auch das nächste Rent a car am Flughafen von Des Moines weit entfernt liegt.
Sargnagel schildert jede Menge Banalitäten – auch private wie ihre Handy-Affinität, Vorliebe für US-Konfektionsware-Serien, Pummeligkeit, ihr Alkoholikerinnen-Problem und sogar ihre Onaniepraxis. Oder ihr spätpubertäres Bedürfnis nach Renitenz: Sargnagel raucht z.B. genau dann Kette, wenn sie merkt, dass ihre Pafferei unter College-Kolleginnen Irritation auslöst. Das kommt daher wie ein etwas überarbeitetes Tagebuch und stellt vor die Frage: Muss ich das alles wissen? Etwas kurz geraten demgegenüber Passagen über die für Europäer:innen verstörende Waffen-Omnipräsenz oder der Kommunismus-Generalverdacht vieler Amis gegenüber allem, was wir hier als soziales Netz schätzen.
Ein Lichtblick in „Iowa“ sind die Dialoge mit der – leider nach zwei Drittel des Buches wieder abreisende – Christiane Rösinger. Ihre Berliner Schnauze kommt auch (originelle Idee!) in Fußnoten selbst zu Wort, in denen sie manche Ungenauigkeiten ihrer Busenfreundin wieder zurechtrückt. Und die alten Lassie-Singers-Hits sind eine echte Entdeckung.
Archiv des Monats: März 2025
„Like a complete unknown“, James Mangold (US 2024) **** 5.3.25
Ich sah „Ray“, „Rocketman“, „Bohemian Rhapsody“, und „Like a complete Unknown“ reiht sich in diese Liste gelungener Filme über Musikstars (Ray Charles, Elton John, Freddy Mercury) bestens ein. Diesmal geht es um den jungen Bob Dylan, von Timothée Chalamet oscarwürdig und auch sängerisch überzeugend dargestellt als anpassungsunwilliger Genius. Dylan kommt noch als Teenager nach New York, besucht sein nervenkrank dahinsiechendes Idol Woody Guthrie im Spital, wo auch Pete Seeger dem Folk-Veteranen huldigt. Auch Joan Baez, einige Monate älter als Bob und schon ein Star der Folk-Szene, gerät in den Bann des Riesentalents aus dem mittleren Westen, der großartige Songs nur so aus dem Ärmel schüttelt.
Zum Sympathieträger wird Dylan in dem Film ja nicht. Beziehungsunfähig, renitent, provozierend, sich jeder Erwartung und jedem „Hit-Abspulen“ verweigernd, bleibt er als schwieriges Genie irgendwie unberechen- und undurchschaubar. Und beim Auftritt Dylans auf dem Newport Folks Festival kommt es 1965 zum Eklat. Er bleibt a Complete Unknown…
Zum 80er von Joan Baez 2021 kam eine Biografie heraus, in der sie auch auf die Beziehung zu Bob Dylan eingeht. Die kenne ich nicht – leider. Muss nachgeholt werden. Vor dem Oeuvre des einzigen Nobelpreisträgers aus der Welt der populären Musik kann ich mich nur verneigen.
Ausstellung 3.3.25. „Matthew Wong – Vincent van Gogh. Letzte Zuflucht Malerei“, Albertina *****
Matthew Wong (1984-2019), kanadischer Maler mit chinesischen Wurzeln, empfand sich als Geistesverwandter van Goghs. Beide waren von labiler psychischer Gesundheit, beide waren Autodidakten und hatten manische Arbeitsphasen, in denen ihnen die Malerei als „letzte Zuflucht“ diente. Der durch Suizid ums Leben gekommene Wong orientierte sich stark am flackernden Pinselstrich und auch an der Themenwahl des großen Niederländers. „Ich sehe mich selbst in ihm. Die Unmöglichkeit, Teil dieser Welt zu sein“, schrieb Wong einmal über sein Vorbild.
Vor einigen seiner 44 Gemälde stand ich länger und war beeindruckt von der emotionalen Wucht der dargestellten Einsamkeit, der Verlorenheit, der Lebensmüdigkeit. „See you on the other side“ betitelte Wong sein letztes (?) Bild. Darauf zu sehen. Eine einsame Gestalt, die vor einer leeren weißen Fläche auf ein offenbar ersehntes Gegenüber, ein schon nahes Jenseits blickt

kurz vor seinem Suizid
Ausstellung 17.2.25 „Hundert Jahre Radio“, Technisches Museum Wien ***
„Als Österreich auf Sendung ging“, lautet der Untertitel der aktuellen Sonderausstellung im gerade umgebauten TMW. In vier Räumen und auf vielen Hörstationen wird, für Historikerinnen und Techniker interessant, Radiogeschichte ausgebreitet, beginnend mit der ersten Radioansage „Hallo, hallo! Hier Radio Wien auf Welle 530“ im Oktober 1924. Dann weitere Meilensteine österreichischer Zeitgeschichte von Schuschniggs „Gott schütze Österreich“ über die Hitlerrede am Heldenplatz 1938 und Goebbels düsterem Kriegsbericht im Feber 1945 bis hin zu Figls „Österreich ist frei“ 1955 im Belvedere. Danach häufen sich Tondokumente zu weniger gewichtigen Themen wie Schranz‘ Olympiaausschluss 1972, Cortis „Schalldämpfer“ oder Udo Hubers „Die großen 10“. Auf den Vitrinen waren alte Empfangsgeräte wie der „Volksempfänger“ zu sehen, die mich im Fall von tragbaren Radiorekordern an meine Jugend erinnerten…
Eh nett. Aber ein wenig interaktiver hätte man das schon gestalten können. Und ins TMW gehe ich erst wieder, wenn die neuen Ausstellungsflächen fertig sind.

Ausstellung 4.2.25 „Chagall“, Albertina ****
Marc Chagall (1887 – 1985) kenne ich von seinen bemerkenswerten Glasfenstern im Zürcher Münster. Der Surrealist, der nicht so genannt werden möchte, zählt zu den bekanntesten Künstlern des 20. Jahrhunderts, dessen unverwechselbares Schaffen einen Zeitraum ab 1905 bis in die 1980er-Jahre umspannt. Aufgewachsen in der heute belarussischen Kleinstadt Witebsk als Kind einer orthodoxen jüdisch-chassidischen Arbeiterfamilie blieben die frühen Kindheitserfahrungen des später in Frankreich beheimateten Moische Chazkelewitsch Schagal stets prägend.
Auch wenn ich mit den traum-haften, eigenwilligen Bildern nicht immer was anfangen kann, beeindruckt mich doch, zu welch künstlerischer Eigenständigkeit jenseits gängiger Kunstströmungen manche Meister doch gelangen. Hier male ich – und kann nicht anders, scheinen Chagalls Werke zu sagen. Chapeau!

Ausstellung 8.1.25 „Rembrandt – Hoogstraten. Farbe und Illusion“, KHM *****
Meine erste Ausstellung als Nutzer der Bundesmuseen-Card führt mich ins Kunsthistorische: Sie veranschaulicht, wie die Kunst Rembrandts nachhaltigen Eindruck auf seinen begnadeten Schüler Samuel van Hoogstraten machte. Beide waren Meister der Illusion, ein Trompe ‚Augenbetrüger“(Trompe-l’œil)-Stillleben Hoogstratens mit täuschend echt gemaltem Rahmen verblüfft auch heute noch, da Fotorealismus dank technischer Hilfsmittel allgegenwärtig ist. Beeindruckend auch die ausdrucksstarken Porträts der beiden Niederländer.
Abseits der Sonderausstellungen gibt es im architektonisch faszinierenden KHM auch sonst viel zu entdecken. Sicher nicht mein letzter Besuch heuer.

RME schreibt weiter …
Hervorgehoben

RME lautete mehr als 30 Jahre lang mein Kürzel als Nachrichtenredakteur. Seit Anfang 2025 pensioniert, arbeite ich, Robert Mitscha-Eibl, nicht mehr „nine to five“, sondern (als) freier. Und ich schreibe weiter Artikel, Kommentare, Kulturkritiken, Reiseberichte, Adventmails. Über Themen, die mich (und vielleicht auch dich) interessieren. Weil mich das geistig rege hält, es mir Spaß macht und ich mich gerne mit Freund:innen über Gott und die Welt austausche. Und auch, weil das hier etwas ist, mit dem ich mich bei meinen Nachkommen in Erinnerung halten möchte.
In Pension – und was jetzt?
Viel reisen, Rad fahren, lesen, Beziehungen pflegen, und als Journalist muss ich ja arbeitsmäßig nicht von 100 auf 0 Prozent wechseln … so umschrieb ich meine Erwartungen an die Pensionszeit vor deren Antritt mit Jahreswechsel 2024/25. Nach gut zwei Monaten eine erste Bilanz: Es ist schon sehr viel anders geworden in meinem Alltag.
Schon alleine das Wegfallen des von der Arbeit dominierten Tagesablaufs: Kein Wecker läutet mehr um 7 Uhr und mahnt zum Aufbruch in die Redaktion. Dafür ausgedehntes Frühstück mit ausgiebiger Zeitungslektüre. Ausstellungsbesuche mit der zu Weihnachten geschenkten Bundesmuseen-Card. Mehr Zeit als je zuvor mit der ebenfalls frisch pensionierten Ehefrau verbringen (was schon davor zutage tretende Unterschiede im Lebensstil noch offenkundiger macht). Den Kontakt mit meinen Söhnen und deren Familien intensivieren – was auch an zwei neugeborenen Enkelinnen im Februar innerhalb von nur 24 Stunden lag. Ausflüge nach Bad Tatzmannsdorf, Bad Schönau und Graz. Joggen an der Alten Donau. Zeit verplempern durch Internetsurfen, TV und Videos in den Social Media.
Etliches noch auf der To-do-list, z.B. eine Form sozialen Engagements, die „egoistische“ Pläne wie Reisen erlaubt. Immerhin: eine eigene Website als Großprojekt zumindest ansatzweise umgesetzt.
Also: Vieles noch ungewohnt, aber ich übe …

„Der Lehrer, der uns das Meer versprach“ (Patricia Font, Sp 2023) **** 3.3.25
Spanien war noch eine brutale Diktatur, als ich längst geboren war. Bis 1975 dauerte das Franco-Terrorregime, dem Tausende Oppositionelle zum Opfer fielen, viele davon namenlos in Massengräbern verscharrt. Einer davon war Antoni Benaiges (Enric Auquer), der kurz vor Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs Grundschullehrer in einem kleinen, abgelegenen Dorf in der Provinz Burgos wird. Dank seiner fortschrittlichen, antiautoritären Unterrichtsmethoden baut er schnell eine vertrauensvolle Beziehung zu seiner Klasse auf. Doch der freundschaftliche Umgang mit den Kindern wird von Eltern und Dorfgrößen argwöhnisch beobachtet und dann von den faschistischen neuen Machthabern brutal beendet.
Dieser historischen Person auf der Spur geht in der etwas aufgesetzten Rahmenhandlung die Enkelin eines inzwischen schwer kranken Ex-Schülers von Benaiges. Im Zuge der Exhumierung von Franco-Opfern schafft es Ariadna, ihrem Großvater ein Stück verlorene Lebensgeschichte zurückzugeben.
Ausflug 25.-28.2.25 Graz
Ach, Graz. Dorthin zu fahren – diesmal mit der Bahn mit wohlfeilem Sparschiene-Ticket, ist jedes Mal wie ein Stück heimkommen – obwohl ich schon seit 40 Jahren nicht mehr dort wohne. Einiges hat sich seither verändert: das „friendly Alien“ (Kunsthaus) wurde gebaut, die Acconci-Insel in der Mur, die Theolog:innen verließen die Hauptuni. Ich bezog Quartier bei lieben Freunden, den Pichlbauers, in deren gemütlichem Haus am westlichen Stadtrand, traf mit Pepi PT einen weiteren Gefährten aus meiner Studienzeit (bei einer Vernissage im Kunsthaus), stieg wie so oft auf die gotische Doppelwendeltreppe, kaufte in der Buchhandlung Moser ein, labte mich im Café Promenade, wanderte die hübsche Innenstadt ab, holte Atem in der Stadtpfarrkirche (wo ich mich wunderte, dass ich an dieser Oase der Stille alleine blieb (siehe Instagram). Und besuchte natürlich meine Geschwister: Martina in ihrer neuen Wohnung nahe dem Lendplatz, Andreas an seinem 55. Geburtstag im Restaurant unter seiner Wohnung – nachdem meine Nichte Rosa im Hinblick auf ihre Erstkommunion getauft wurde.
Schön war es auch, den Leiter des „Kultum“, Johannes Rauchenberger, in Begleitung DES Brückenbauers zwischen Moderner Kunst und Theologie, Friedhelm Mennekes SJ, zu treffen und von ihm ermuntert zu werden, die neue Ausstellung über Kultum-Gründer Josef Fink schon vor der Eröffnung zu besuchen. Den attraktiven Rahmen dafür bietet das umgebaute, seit 50 Jahren bestehende Kulturzentrum, in dem glaubensoffene Kunst und Kultur eine einladende Heimstatt hat. Ich komme wieder – ins Kultum, und nach Graz sowieso.