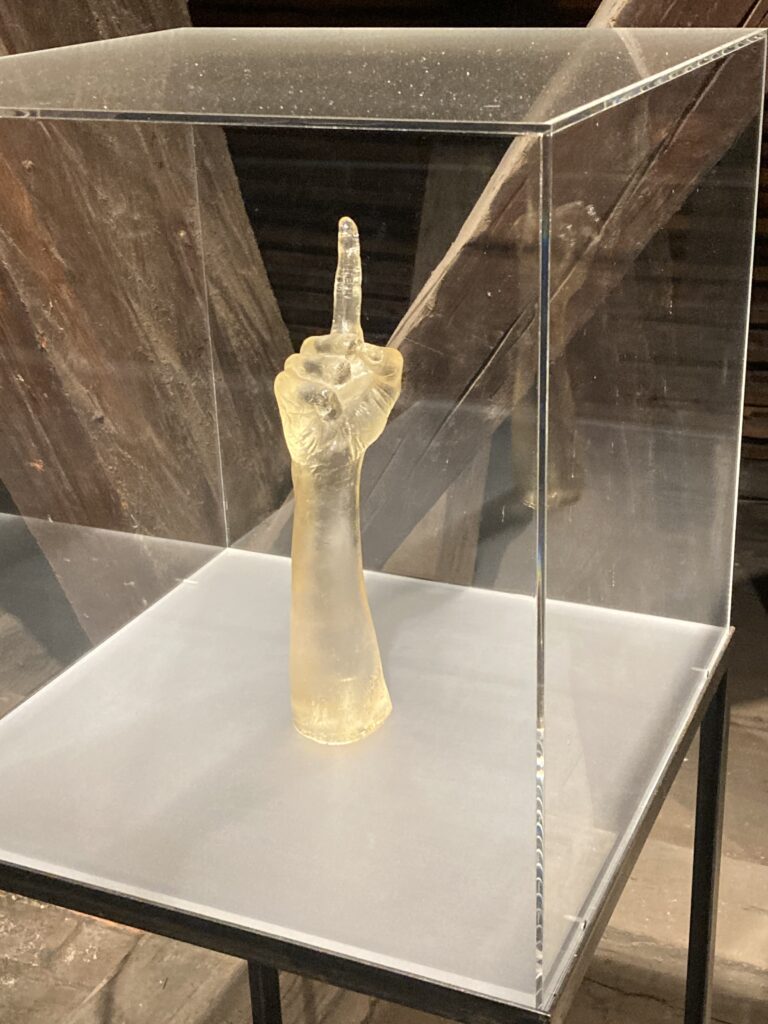Frans Hals, Jan Vermeer, Peter Paul Rubens und natürlich Rembrandt – die alle kennt man als Meister der niederländischen Barockmalerei. Eine, die aufgrund ihrer künstlerischen Qualität unbedingt in diese prominente Reihe dazugehört, kannte ich vor der aktuellen Sonderschau im KHM nicht, hatte ihren Namen noch nie gehört: Über Michaelina/Michelle/Michelina/Magdalena Wautier/Woutiers/Wouters/Wauters (1614?-1689; so viele Namensvarianten!) ist generell wenig bekannt. Sie stammte aus Mons in Flandern und wirkte mit ihrem ebenfalls hochbegabten Malerbruder Charles Wautier in Brüssel; viele ihrer großartigen Gemälde wurden ihr erst in jüngster Zeit zugerechnet – oft auch, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass eine Frau Aufträge für Historienbilder bekam und sie diese mit nackten Männerleibern versah. Und die Künstlerin tat das selbstbewusst: Michaelina „invenit et fecit“, signierte sie ihre Bilder – „erdacht und ausgeführt“. Eine Frau, „die sich in ihrer Zeit über Regeln und Konventionen hinweggesetzt hat und von der Kunstgeschichte vergessen wurde“.



Umso dankenswerter ist es, dass das Kunsthistorische Museum in Wien
dieser „aufregendsten kunsthistorischen Wiederentdeckung der letzten Jahrzehnte“ eine Bühne gibt und Bewunderern wie mir einen Überblick über das bisher bekannte breite Schaffen der Flämin, mit psychologisch einfühlsamen Altarbildern und Porträts, mit Genre- und Historienmalerei sowie Frauen eher zugetrauten „Blumenstücken“, verschafft. Erstmals weltweit zu sehen eine großartige Bilderserie zu den fünf Sinnen, allegorisch dargestellt anhand von kleinen Buben.

Dank gebührt auch dem Habsburger-Erzherzog Leopold Wilhelm von Österreich, der als Statthalter der spanischen Niederlande als Kunst-Mäzen und Käufer agierte und u.a. Michaelina Woutiers förderte. Aus dieser Zeit stammen vier ihrer Bilder in den Beständen des KHM.
Empfehlen kann ich die Schau nicht mehr – ich besuchte sie mit meiner ebenfalls begeisterten Angetrauten am vorletzten Ausstellungstag. Wie gut, dass ich das Wetter – Wien versank im Schnee – für diesen Fast-Last-Minute-Besuch nutzte. Und ich hoffe, dass die Kunsthistoriker:innen noch weitere Werke Michaelinas enttarnen (ärgerlich, dass sich die Talente von Frauen oft nur schwer oder gar nicht durchsetzen konnten!).