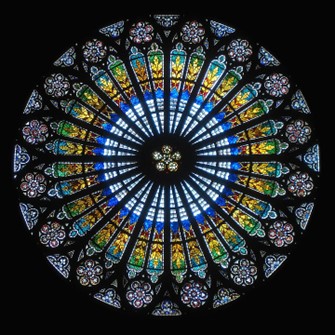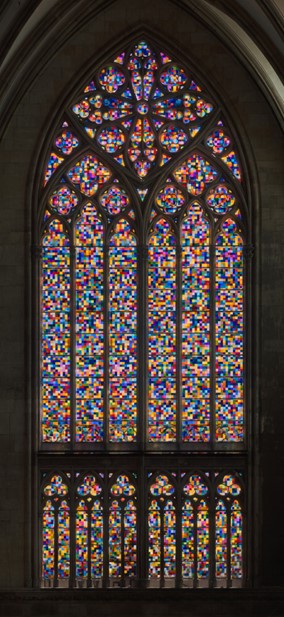Heute – passend zur eben beendeten Schach-WM – eine Art Schachspiel zwischen weißen und schwarzen Figuren. Weiß beginnt sonst immer, ich starte mit …
… Roy Black. Der hieß eigentlich Gerhard Höllerich und wurde als Kaufmannssohn und Kriegskind 1943 in der Gegend von Augsburg geboren. Statt sein Betriebswirtschaftsstudium abzuschließen, begann er nach Anfängen als Rock’n’Roller in den 1960er-Jahren eine erfolgreiche Karriere als Schlagerfuzzi. Black nannte er sich wegen seiner schwarzen Haare, Roy wegen seiner Vorliebe für Roy Orbison. Roys Single „Du bist nicht allein“, die manche von euch als Titelmelodie der ORF-Kuppelshow „Liebesgeschichten und Heiratssachen“ kennen, wurde sein erster kommerzieller Erfolg, der Schmachtfetzen „Ganz in Weiß“ 1966 sogar zum Nr. 1 Hit. Schon 1971 verzeichnete Black seinen letzten großen Erfolg mit dem Kinderliedduett „Schön ist es auf der Welt zu sein“.
Danach gings bergab. Über den „Schnulzensänger“ wurde die Nase gerümpft, ORF-GI Gerd Bacher verfügte einen gegen Black gerichteten Schnulzenerlass auf dem noch jungen Sender Ö3, was nicht nur André Heller als „Ent-Roy-Blackisierung“ begrüßte. Sein Millionenvermögen verlor Black durch unredliche Berater, er litt unter Scheidung, Alkoholexzessen, Depressionen, Selbstmord des Vaters. Sein eigener früher Tod 1991 allein und schwer alkoholisiert in einer Fischerhütte war von Suizidgerüchten begleitet. Dass er Probleme mit seinem Image hatte, zeigt sei Lieblingswitz: Wie bekommt man das Gehirn eines Schlagersängers auf Erbsengröße? – einfach aufblasen!
Auch Barry White hieß nicht so, sondern wurde als Barrence Eugene Carter 1944 in Texas geboren. Die große Zeit des übergewichtigen Soul- und Disco-Stars – Spitzname „The Walrus of Love“ – waren die 1970er-Jahre. Wäre interessant, wie viele Liebesakte Barry mit seinem erotisch-sonoren Sprechgesang in Songs wie „Never, Never Gonna Give Ya Up“, „You’re the First, the Last, My Everything“ oder „Can’t Get Enough of Your Love, Babe“ akustisch begleitete. Naja, bei DIESER Stimme … In seiner Autobiografie behauptet Barry, seinen Stimmbruch im Alter von 14 Jahren zweimal hintereinander gehabt zu haben; dadurch sei er erst zum Tenor und dann zum tiefen Bass geworden. Hört mal in das Intro zum von ihm gecoverten Billy-Joel-Hit „Just the way you are“ an: Diese Gottesgabe verhalf dem Crooner zu mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern.
Back to black, in weiblicher Ausgabe: „La Negra“ – die Schwarze – nennen sich gleich drei Sängerinnen aus dem spanischsprachigen Teil der Welt. Toña la Negra (eigentlich Maria Antonia del Carmen Peregrino Álvarez) stammt aus Veracruz und starb 1982 in der Hauptstadt ihres Heimatlandes Mexiko – nach einer gefeierten Karriere als Bolero-Interpretin.
Auf Amparo Velasco, die auch unter La Negra veröffentlicht, stieß ich zufällig auf Spotify. Wo man trotz ihrer beeindruckenden Stimme und ihrer musikalischen Mischung aus Flamenco, Jazz, lateinamerikanischen und afrikanischen Einflüssen kaum was über die aus Alicante stammende Spanierin erfährt. „Hard to categorise but easy to love“ heißt es auf Womax über die Canciones dieser Negra.
Die berühmteste der Negras ist die mit diesem Spitznamen bedachte argentinische Ikone Mercedes Sosa (1935-2009), deren „Gracias a la vida“ mich immer wieder tief berührt. Als Österreichs Kicker 1978 in Cordoba die deutschen Noch-Weltmeister 3:2 putzten und Edi Finger darob dem Herzkasperl nahe war, waren die sozialkritischen Platten der Sosa verboten. Die Militärjunta ließ die Sängerin 1979 bei einem Konzert mitsamt Publikum verhaften, bis zu deren Sturz blieb sie im spanischen Exil. Ihr Konzert im Opernhaus Buenos Aires wird oft als Schlüsselereignis in der Übergangszeit gewertet und steht für eine politische und musikalische Erneuerung der argentinischen Kultur – Gracias a la Sosa!
Der nächste „Weiße“ ist ein Weltenbürger. Roberto Blanco – er heißt wirklich so – wurde 1937 in Tunis als Sohn eines kubanischen Künstlerpaars geboren. Als Halbwaise wuchs er zunächst in Beirut auf, wo er als einziger Junge in einem von Nonnen geführten Mädcheninternat erzogen wurde, danach bis zum Ende der Schulausbildung in Madrid. 1956 kam er mit seiner Familie nach Deutschland, wo er Schlagerstar und 1971 eingebürgert wurde. Einen Skandal gab’s, als sich Roberto nach 50 Jahren von seiner Schweizer Frau Mireille trennte und eine 42 Jahre jüngere Kubanerin heiratete. Dass er in finanzielle Turbulenzen geriet und sich Unterhaltszahlungen entzog, griff Roberto gemäß seinem größten Hit „Ein bisschen Spaß muss sein“ selbstironisch in der Video-Parodie „Ein bisschen spar’n muss sein“ auf.
Der letzte Schwarz heißt Berthold und war angeblich ein Franziskaner und Alchemist im 14. Jahrhundert aus Freiburg im Breisgau. Er gilt heute unter Historikern als fiktive Gestalt und die ihm zugeschriebene Erfindung von Schwarzpulver und Kanonen als Legende. Aber die erzählt sich gut:
Bei chemischen Experimenten zerstampfte Berthold in einem Mörser Salpeter, Schwefel und Holzkohle, stellte diesen mit dem Stößel zusammen auf den Ofen und verließ den Raum. Kurze Zeit später großes Karacho. Die herbeigeeilten Ordensmänner stellten fest, dass der herausgeschleuderte Stößel so fest in einem Deckenbalken steckte, dass er selbst nach Berühren mit den Reliquien der heiligen Barbara nicht herausgezogen werden konnte. Anschließend dienten die verwendeten Mörser bzw. Töpfe Berthold als Vorlage für erste primitive Kanonen. Auf diesen Vorfall sollen die Bezeichnung für das (längst davor in China erfundene) Schwarzpulver, der Name „Mörser“ für kurzläufige Steilfeuergeschütze und die heilige Barbara als Schutzpatronin der Artilleristen zurückgehen.
Kurz erwähnt seien noch Jack White, Mastermind der Garage-Rock-Band The White Stripes („Seven Nation Army“!), und Jack Black, exaltierter Sänger und Schauspieler („School of Rock“).
Zuletzt noch ein rockiger Schwarzweiß-Ausklang auf Spotify.