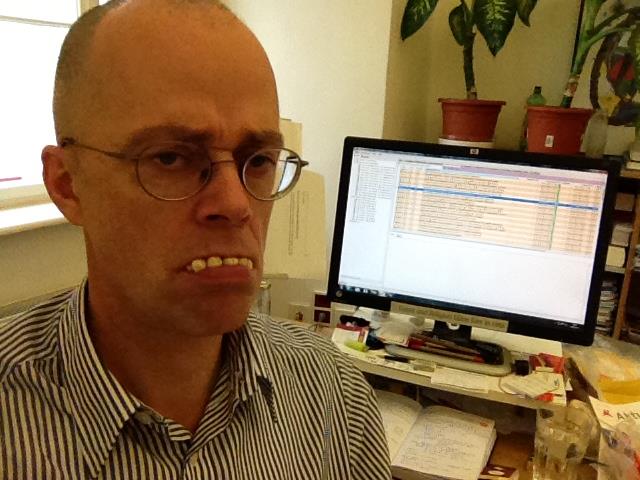Heute die besten Songs über Anfang/Ende, anzuhören über DIESE Spotify-Liste:
Nina Simone: Feelin‘ Good „It’s a new dawn, it’s a new day. it’s a new life for me. And I’m feeling good“, singt Nina Simone hier Mitte der bewegten Sixties. Und man glaubt es der selbstbewussten Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, in deren Version dieses oft gecoverten Songs die Instrumentierung erst in Sekunde 39 einsetzt.
John Lennon: (Just Like) Starting Over Ein Song aus Lennons Todesjahr 1980, die letzte Single zu seinen Lebzeiten – und seien wir ehrlich: Die von ihm als „Elvis-Orbison-Nummer“ gedachte Komposition ist bei weitem nicht seine beste, nicht mal in meinen Top 10. Und sie war zunächst auch nicht sonderlich erfolgreich, wurde das erst nach der Ermordung der Legende. Aber es ist John! Lennon!!
Rolling Stones: Start Me Up Mit diesem einfach gestrickten 3-Akkorde-Song von Jagger/Richards eröffnen die Stones seit dem Paläolithikum ihre Konzerte. „If you start me up, I’ll never stop“, singt der 82-jährige Mick, und ich hoffe mit vielen, dass er noch lange mit seinen Steinen rollt.
Stevie Wonder: Isn’t She Lovely Mein Soul-Liebling at his best. Dieses Lied aus seinem wunderbaren Doppelalbum „Songs in the Key of Life“ (1976) schrieb er anlässlich der Geburt seiner Tochter Aisha (die Lebendige), in der Langversion ist auch Babygeplapper beim Baden zu vernehmen. Ich hörte das Album in einem Urlaub vor 25 Jahren mit meinen drei Söhnen rauf und runter; zwei von ihnen bekamen heuer ebenfalls Töchter.
Bright Eyes: First Day Of My Life Eine hübsche Komposition des US-Alternative-Stars Conor Oberst, der die Band Bright Eyes bereits als 15-Jähriger gründete. Seine brüchige Stimme auf seinem (inzwischen auf Spotify meistangeklickten) Folk-Song hat Charme und verbreitet Lagerfeuerfeeling.
Simply Red: Something Got Me Started Bei Simply Red war ich in den 1990ern in der Stadthalle in einem Life-Konzert, weil ich die funkig-soulige und gut arrangierte Musik von Mick Hucknall mochte. Allerdings merkte ich, dass die große Halle in Bezug auf Atmosphäre kleineren Spielorten klar unterlegen ist, heute gehe ich viel lieber in kleine Räume.
Ella Fitzgerald/Duke Ellington: I’m Beginning To See The Light Über die Zusammenarbeit von Ella und dem „Duke“ sang Stevie Wonder, manche Musikpioniere dürften einfach nicht vergessen werden. „The king of all Sir Duke / And with a voice like Ella’s ringing out / There’s no way the band can lose“. Stimmt genau, das hört man auch auf dieser Ellington-Komposition aus dem Jahr 1944.
David Bowie: Absolute Beginners Pop-Chamäleon Bowie schrieb diesen Hit für den gleichnamigen Film über „Absolute Beginners“, also Erwachsene ohne Beziehungserfahrung, im Londoner Stadtteil Notting Hill. „As long as we’re together / The rest can go to hell“, textet hier der großartige Songschreiber, der viel zu früh verstarb.
Carpenters: We’ve Only Just Begun Ja klar, dieses Lied des Geschwisterduos Richard und Karen Carpenter hat was Schnulziges. Aber die wunderbare Alt-Stimme der lange magersüchtigen, bereits 32-jährig verstorbenen Karen adelt die Soft-Pop-Songs der beiden, die in den 70ies ein breites Publikum fanden.
Beginner: Hammerhart Rap ist ja an sich nicht so meins, aber bei dieser Hamburger Band mit ihrem adventmailpassenden Namen mach ich ma ne Ausnahme. Die Vorzüge des nunmehrigen Trios formuliert der Refrain: „Ihr seid Zeuge, wie Denyo ’n neuen Hit schreibt / Eißfeldt die fetten Beats holt, aus’m Zip-Drive / Mad seine neuesten Technics Tricks zeigt / Arfmann an den Reglern macht den Shit tight.“ Jan Eißfeldt/Jan Delay ist auch solo einer meiner deutschen Lieblinge.
Beatles: Hello, Goodbye Dieser Beatles-Song bildet sozusagen die Bridge zu den Songs über Aufhören/Abschied/Ende. Es thematisiert Gegensätze – neben hello/goodbye auch ja/nein, stop/go, high/low … und zeigt das unglaubliche Talent McCartneys für eingängige Melodien. Lennon mochte den Song nicht besonders, hätte lieber „I Am The Walrus“ auf der A-Seite der Single aus dem Jahr 1967 gesehen. Was für eine produktive Konkurrenz das doch war!
Georg Danzer. Ruaf mi ned an Dieses so wienerische Beziehungsende-Lied ist mein favourite und das meistgecoverte vom Schurl. „Weit host mi brocht / i steh auf in der Nacht / und dann geh i spazier’n / Ganz ohne Grund, i hob net amoi an Hund / zum Äußerln fiarn…“ Selten ist Seelenpein so anschaulich und berührend geschildert worden. Und auch der Reim „Porsche“ und „Oasch geh‘“ ist genial.
Reinhard Mey: Gute Nacht, Freunde Einer der großen Texter der deutschen Liedermacherszene verdient hier auch Erwähnung. Mey-Lieder wie „Ihr Lächeln war wie ein Sommeranfang“ sang ich schon als Jungstudent an den Ufern der Isar während meines Wienerwald-Ferienjobs; später als Theologe, als wir statt „Über den Wolken“ grinsend „Unter Soutanen“ sangen. Und „Sommermorgen“ ist eines der schönsten Liebeslieder, das ich kenne.
Sarah Brightman/Andrea Bocelli: Time To Say Goodbye An dieser Melodie und diesen Stimmen komme ich nicht vorbei: 1996 nahmen Andrea Bocelli und die englische Sopranistin Sarah Brightman das italienisch „Con te partirò ( „Mit dir werde ich fortgehen“) betitelte Lied von Francesco Sartori. Kurios: Das Stück wurde als Eröffnungslied beim Boxkampf von Henry Maske gegen Virgil Hill unter dem heutigen Titel Time to Say Goodbye bekanntgemacht.
Madonna: The Power Of Good-Bye Es gibt ein Album der davor allzu sehr als „Material Girl“ agierenden Madonna, das ich in meine All-Time-Favourites einreihe: Ray Of Light (1998). Neben „Frozen“ einer der schönsten Songs darauf ist dieser für ihren Ex-Mann, den Schauspieler Sean Penn, komponierte. Im Text spricht sich Madonna dafür aus, sich von etwas zu lösen, das einem nicht guttut.
Adele: Someone like You Noch ein Beziehungsendelied – und vielleicht das schönste, das ich kenne. Adele singt hier auf ihrem zweiten Album „21“ über die ambivalenten Gefühle bei einer Trennung: „Never mind, I’ll find someone like you. / I wish nothing but the best for you too. / Don’t forget me, I beg! / I remember you said, / ‚Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.“ Ganz schön reif für eine am Beginn ihrer 20er. Und was für eine mitreißende Interpretin!
Bob Dylan: It’s all over now, Baby Blue „Jetzt ist alles vorbei, Baby Blue“… An wen His Bobness diese Abschiedsworte richtete, bleibt unklar (vielleicht weiß es mein Freund, der Dylanologe Dr. No?). Es wurde darüber spekuliert, ob Dylan mit dem Song seine Trauer über die vergebliche Liebe zu Joan Baez besingt oder vielleicht seine Distanzierung von puristischer Folkmusik. Eine musikalisch beachtliche Version des Songs stammt übrigens von Van Morrison und Them.
Wolfgang Ambros: Heite drah i mi ham „Es lebe der Zentralfriedhof“ war 1975 ein Meilenstein des Austropop, das Duo Ambros/Prokopetz war auf dem Höhepunkt seiner Kreativität. Das genannte Lied über Suizid mittels aufgeschnittener Pulsadern stammt jedoch von Georg Danzer, wie auch „A Gulasch und a Seidl Bier“. Alle anderen komponierte Ambros, der heute leider ein vom Leben Gezeichneter ist.
Earl Grant: The End Als Posthum-F1-Weltmeister Jochen Rindt 1970 auf dem Wiener Zentralfriedhof begraben wurde, spielte man sein Lieblingslied, gesungen vom akustischen Nat-King-Cole-Lookalike Earl Grant, der nur drei Monate vor Rindt auch bei einem Autounfall starb. Eine deutschsprachige Version („Jeder Traum hat ein Ende und Schatten folgt dem Licht / Jeder Tag geht zur Neige, doch unsre Liebe nicht…) sang Grant kurz nach der englischen in den USA ein.
The Doors/The Beatles: The End Etwas langatmig klingt heute die rauschgiftgeschwängerte 11‘43‘‘-Version des längsten Songs der US-Kultgruppe rund um Jim Morrison. „My only friend, the End“ singt der 27-jährig Verstorbene darin etwas morbid. Wie eine Kontrastversion dazu in Länge und Inhalt dazu wirkt das gleichnamige Liedfragment der Beatles, das das großartige Abbey-Road-Album beschließt. „And in the end, the love you take, is equal to the love you make“ textete Paul McCartney nach dem Vorbild von Shakespeare-Zweizeilern. John Lennon nannte das „a very cosmic, philosophical line“ von Paul. Und fügte ironisch dazu. „Which again proves, that if he wants to, he can think.“